„Das Genehmigungsverfahren, die staatliche Aufsicht, kürzer und nicht wenig klar gesagt: die Zensur der Verlage und Bücher, der Verleger und Autoren, ist überlebt, nutzlos, paradox, menschenfeindlich, volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar.“ (Christoph Hein, 1987)
Schmähungen, Verfolgung und Haft, Druckverweigerung, Bücherverbrennung: Die Möglichkeiten, wie frühere Herrscher in den Literaturbetrieb eingegriffen haben, sind komplex und reichen weit über den berühmt-berüchtigten Rotstift hinaus. Das Ziel bleibt hingegen gleich: die Macht und das System zu bewahren. Und da spielt es keine Rolle, in welche Kapitel der Weltgeschichte man blickt. Der renommierte amerikanische Wissenschaftler Robert Darnton berichtet in seinem jüngsten Werk „Die Zensoren“ über drei verschiedene Länder und drei verschiedene Jahrhunderte.
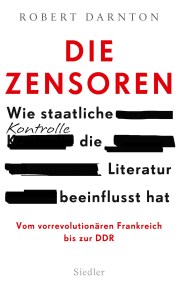
Das vorrevolutionäre und aufklärerische Frankreich, Britisch-Indien sowie die DDR sind die autoritären Systeme, denen sich Darnton widmet. Vorausgegangen sind akribische Recherchen in allen drei Ländern: im Archiv der Bastille und in der französischen Nationalbibliothek, im Archiv des Indian Civil Service sowie in der einstigen Hauptverwaltung Verlage und Buchhandlung und im SED-Parteiarchiv in Berlin. In die heutige Bundeshauptstadt kam Darnton infolge seiner Studien am Wissenschaftskolleg kurz nach der Wende. Hier konnte er zwei einstige Zensoren, Mitarbeiter der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandlung, direkt interviewen. Dieser dritte Teil ist wohl der lebendigste dieses Buches, das auf eindrucksvolle Art und Weise nicht nur viele Quellen und viele Fakten vereint, sondern Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Systemen deutlich herausstellt.
Grundlage der Herangehensweise ist der Gedanke, dass Zensur nicht nur symbolhaft den Rotstift und die Streichung von Passagen meint, sondern ein komplexes System aus Behörden und Institutionen sowie einer ganzen Reihe möglicher Maßnahmen umfasst. Zudem bettet Darnton seine Recherche-Ergebnisse in einem weit gespannten Rahmen ein. Sein Blick richtet sich nicht nur auf die Strukturen der Macht. Vielmehr fließen die Bereiche Geschichte, speziell Literaturgeschichte, sowie Hinweise zu der die Literatur beherrschenden Strukturen ein. Ziel der Zensoren sei es immer, die Kontrolle über die Kommunikation zu übernehmen und zu sichern, um das politische System zu bewahren oder zu stabilisieren. Basis dafür war das Bewusstsein, das Worte, sprich die Literatur sehr viel Macht ausüben. Es ist sehr erstaunlich, dass in allen drei Ländern, so verschieden sie auch sind, sowohl die Literatur einen Boom erlebte oder eine herausragende gesellschaftliche Funktion bekleidete, als auch die Zensur eigentlich verboten war. In Frankreich und Indien war die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung ein Errungenschaft, die als kostbar angesehen und geschützt werden sollte. In der DDR gab es die Zensur offiziell nicht. Um den Repressionen zu entgehen, wurden sowohl in Frankreich als auch in der DDR Werke außerhalb der Grenzen gedruckt und verbreitet, über Umwege schließlich ins Land zurückgeführt.
Trotz der Gemeinsamkeiten arbeitet Darnton gezielt die Unterschiede und besonderen Erscheinungen heraus, so dass ein interessantes wie facettenreiches Panorama jener Zeit und jenes Landes entsteht. So waren die Zensoren in Frankreich, zumeist ehrenamtlich beschäftigt oder wurden nur mit einem geringen Gehalt abgespeist, auch Lektoren und Kritiker, die in die Werke korrigierend eingegriffen haben und sie einzuschätzen wussten. In Indien machten sich die Beamten der kolonialen Verwaltung mit der Literatur des eigentlich fremden Landes und der fremden Kultur vertraut und erstellten Kataloge, in den jeweils die Neuerscheinungen eines Zeitraumes erfasst wurden. In einer Zeit der Unruhen und Kritik an den Fremdherrschern entstand eine Kluft zwischen dem liberalen Anspruch auf Pressefreiheit und der imperialistischen Praxis. Selbst das Land war gespalten – in jene, die den Briten die Hand gereicht und jene, die gegen sie angekämpft haben. Die Zensur in der DDR erscheint schließlich als nächste, weit höhere Stufe in der staatlichen Kontrolle von Literatur. Das hierarchische System aus verschiedenen Ebenen übte nicht nur Einfluss auf einzelne Werke und Autoren aus. Hier wurde zielgerichtet geplant, was gedruckt und was die Bürger zu lesen haben. Es gab sowohl Themen als auch Autoren, die verpönt waren, so dass Werke, selbst von großen Namen wie Nietzsche und Kierkegaard, erst gar nicht genehmigt wurden. Hinzu kamen psychologische Ränkespiele, die unter anderem auch zur Selbstzensur geführt haben.
„Jedweder Eingriff in die Freiheit des Gedankens und des Wortes, mag die Technologie und die Bezeichnung einer solchen Zensur noch so diskret sein, ist im zwanzigsten Jahrhundert ein Skandal und für unsere Anlauf nehmende Literatur eine Fessel.“ (Milan Kundera 1967)
In jedem der drei Hauptkapitel nennt Darnton, der zu den einflussreichsten Wissenschaftlern seines Fachgebietes zählt, als Verfechter der Neuen Kulturgeschichte und als Professor an der Harvard-Universität lehrt und die dortige Bibliothek leitet, auch ganz konkrete Beispiele. Neben den Zahlen und Fakten werden so die Menschen, ihr Wirken und ihr Schicksal herausgearbeitet – Schriftsteller wie Zensoren. Für den Abschnitt zur DDR-Literatur nennt er da unter anderem den einstigen Direktor des Aufbau-Verlages, Walter Janka, die Schriftstellerin Christa Wolf und die Autoren Wolfgang Hilbig, Rainer Kirsch und Volker Braun. So wurde Janka wegen Verschwörung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, erfuhren die genannten Autoren Repressalien der verschiedensten Art: die von der direkten Zensur des Textes (Wolf „Kassandra“) über die Verweigerung eines Umzugs (Kirsch) bis hin zu Schwierigkeiten bei der Ausreise (Hilbig) gereicht haben. Brauns „Hinze-Kunze-Roman“ wird als Beispiel für ein Werk genannt, das erschienen war, schließlich jedoch wieder aus dem Buchhandel genommen und diskreditiert wurde.
Der Band „Die Zensoren. Wie staatliche Kontrolle die Literatur beeinflusst hat“ von Robert Darnton erschien im Siedler Verlag, in der Übersetzung aus dem Englischen von Enrico Heinemann; 368 Seiten, 24,99 Euro


Spannend. Mein Vater war mit einem Schriftsteller in der DDR befreundet. Der ist letztlich an der offiziell nicht vorhanden Zensur zerbrochen. Aber immerhin -die Zeit für „Rummelplatz“ kam noch. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Rezension die den Weg für die Zensoren in mein Bücherregal geebnet hat.
LikeGefällt 1 Person
Vielen Dank für Deinen persönlichen Kommentar. Als ich „Rummelplatz“ vor einigen Jahren gelesen habe, wurde ich auch auf das Schicksal von Werner Bräunig aufmerksam. Ich glaube, es zählt zu den tragischsten und traurigsten in der DDR-Literaturgeschichte überhaupt. Es ist zwar sehr schön, dass seine Werke in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten haben, aber letztlich war ihm dieser Ruhm zu Lebzeiten nicht vergönnt. Ich glaube, dass in Sachen DDR-Geschichte noch weiter viel Aufklärung und Aufarbeitung notwendig ist. Es würde mich sehr freuen, wenn Du das Buch liest und Du mir danach ein kurzes Feedback geben könntest, wie Dir das Buch gefallen hat. Interessant ist natürlich vor allem auch, die Außensicht eines Amerikaners auf die einstigen Geschehnisse. Viele Grüße
LikeGefällt 1 Person